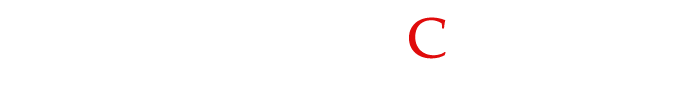Während die japanische Etikette damit beginnt, die Existenz und Würde des anderen anzuerkennen
Während die japanische Etikette damit beginnt, die Existenz und Würde des anderen anzuerkennen, beginnt die Etikette konfuzianischer Gesellschaften mit der Leugnung der Existenz des anderen.
1. April 2017
Ich möchte kurz auf einige Themen eingehen:
– Warum kehren so viele Menschen koreanischer Herkunft, die in Japan leben, trotz ihrer erklärten Abneigung gegen das Land nicht in ihre Heimat zurück?
– Warum sie, obwohl sie behaupten, „gewaltsam hierher gebracht worden zu sein“, niemals eine Rückführung fordern;
– Und warum viele von ihnen, selbst wenn sie sich einbürgern lassen wollen, dies nicht können.
Später in diesem Beitrag sollten Sie sich das Video mit dem koreanischen Universitätsprofessor aufmerksam ansehen.
Am 4. April besuchte Hwang Jang-yop (86), ehemaliger Sekretär der Arbeiterpartei Koreas, Japan.
Seine Reiseroute wurde nicht öffentlich bekannt gegeben – weil der Machtkampf zwischen Nord- und Südkorea auch innerhalb Japans unvermindert weitergeht und es viele gibt, die nicht zögern würden, ihn zu töten.
Übrigens spricht Herr Hwang fließend Japanisch.
Angesichts seines Alters ist es wahrscheinlich, dass er bis zu seinem 20. Lebensjahr mit Japanisch gelebt hat.
Das ist nur natürlich. Korea wurde 1910 (Meiji 43) offiziell von Japan annektiert, und Herr Hwang, der danach geboren wurde, wäre als japanischer Staatsbürger aufgewachsen, hätte eine japanische Ausbildung erhalten und unter einem japanischen Namen gelebt.
Wenn wir das Wort „Kolonie“ hören, denken wir oft an die westlichen imperialistischen Mächte in Asien und Afrika, die Ausbeutung, Diskriminierung und Plünderung mit sich brachten.
Japan verfolgte jedoch den Ansatz einer legalen Annexion.
Im Rahmen dieser Annexionspolitik stellte Japan einen erheblichen Teil seines Staatshaushalts für die Verbesserung der Lebensbedingungen der koreanischen Bevölkerung bereit – für den Aufbau von Bildungssystemen, Eisenbahnen, Straßen, Häfen und anderer wichtiger Infrastruktur.
Siehe: „Korea vor und nach der Annexion – Fotoarchiv“
Man kann sagen, dass Japan mehr gegeben hat, als es genommen hat.
Insbesondere das Leben auf der koreanischen Halbinsel vor der Annexion war von extremer Armut geprägt.
Darüber hinaus hatte die 1922 gegründete Sowjetunion bereits in den 1920er Jahren begonnen, nach Süden vorzustoßen, wodurch die Region an den Rand einer kommunistischen Kolonialisierung geriet.
Vor diesem Hintergrund stand Korea vor einer entscheidenden Wahl: entweder von der Sowjetunion kommunisiert zu werden oder sich Japan anzuschließen. Das war der historische Scheideweg.
Das Leben auf der koreanischen Halbinsel war zu dieser Zeit auch durch ein notorisch rigides Klassensystem geprägt.
Die soziale Hierarchie war streng und ließ sich grob in Gruppen wie Yangban (Aristokraten), Jungin (Mittelschicht), Sangin (Bürger) und Baekjeong (Unberührbare) und Sklaven einteilen.
Es wird gesagt, dass Überreste dieses Klassensystems bis heute bestehen.
Wenn man sich das koreanische Konzept des Bon-gwan ansieht, das die Legitimität und Überlegenheit der Abstammung einer Familie festlegt, kann man die Nachwirkungen erkennen.
Besonders auffällig ist dabei Folgendes:
Während die japanische Etikette mit der Anerkennung der Präsenz des anderen beginnt, beginnt die Etikette konfuzianischer Gesellschaften mit der Leugnung der Präsenz des anderen.
Dies sei ein Produkt der Geschichte der Halbinsel, die von wiederholten Invasionen und Unterwerfungen geprägt ist, sowie ihres langen Erbes der Sklaverei.
Es soll auch erklären, warum Menschen in solchen Gesellschaften Fremden bei der ersten Begegnung kein freundliches Lächeln schenken.
Sie bleiben vorsichtig, bis sie den sozialen Status, den Hintergrund oder das Alter des anderen einschätzen können.
Man kann nicht umhin, verständnisvoll zu nicken, wenn man das hört.
(Fortsetzung folgt.)